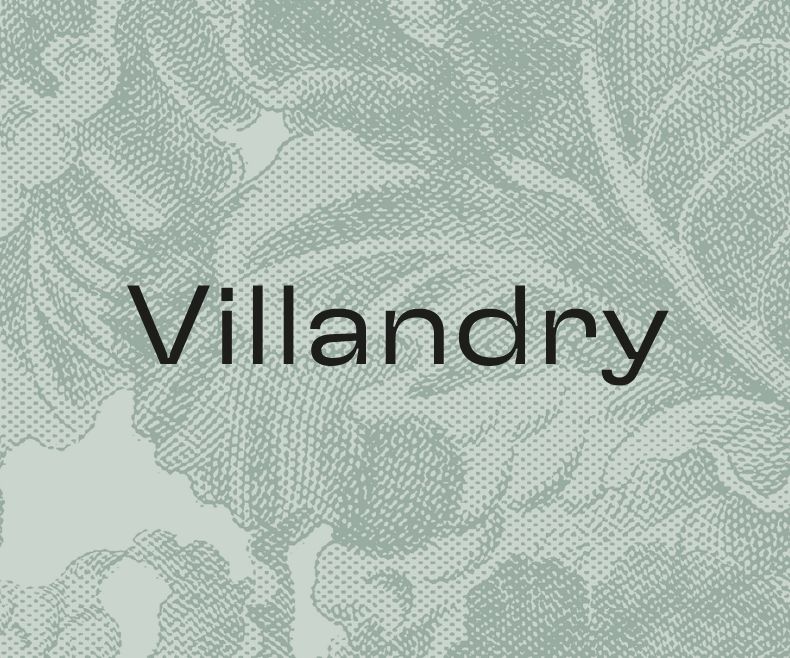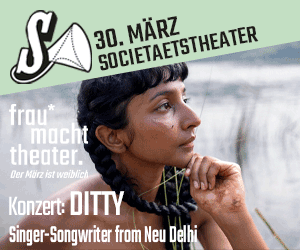Am Donnerstag feierte die Trilogie Wunderblock der Bürgerbühne Premiere. Den Auftakt gab Roswitha – ein Phoenix aus der Kittelschürze.
Eine Wohnung in Orthopädieschuh-Grau. Ein Tisch, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine. Tickende Eieruhren. Ein Fenster. Ein Wandschrank. Darin eine Frau im Blümchenkleid, deren Alltag strukturiert ist von Puddingspausen und Tabletten. Roswitha, Jahrgang ’49, ehemalige Diakonisse. Groß sind ihre Aufschreie – über umgefallene Vasen, aus dem Regal gestürzte Bücher. Kleine Dramen, die sich in den Bühnenvordergrund drängeln, während Roswitha erzählt von den unfassbar großen:
Dem Tod der Mutter, den Übergriffen des Großvaters, der Zeit im Kinderheim, getrennt von der Schwester, dem großen Hunger, der ungenügenden Liebe, dem Mangel an Musik. „Deswegen hat mir das immer so gefehlt. Mein Herz ist so offen dafür.“ Roswithas helles Lachen bricht sich in den Scherben, aus denen ihr Leben zu bestehen scheint. In Rekapitulationen voller Sehnsucht und Witz ordnet sie sie zu einem glitzernden Mosaik. Der Kitt ist das Glück, die Momente voller Schönheit. Die grauen, in die Wand eingelassenen Requisiten ihrer Vergangenheit offenbaren ihre Farben, indem Roswitha sie in die Hand nimmt und wendet.

eine Trilogie der Erinnerung
von Miriam Tscholl. Foto: Bastian Hoppe
Sie bekennt sich zur Sünde und spricht sich frei
Kartoffelschälen, bügeln, stricken – wie nebenbei erzählt Roswitha dem Publikum ihre Lebensgeschichte und macht jeden Einzelnen zum Vertrauten. Aus ihren Handgriffen erwächst eine familiäre Intimität. Gesten, Worte, Formulierungen gleichen den wohlbekannten der Nachbarin, der Tante, der Mutter und Großmutter. Roswithas Ernsthaftigkeit produziert sich aus ihrer Unbefangenheit, ihre Würde entspringt ungebrochenem Humor, ihre Erkenntnis begründet sich in Neugier.
Roswitha wiegt sich im Takt vergangener Tänze so anmutig, wie nur gestandene Damen es können. Sie bekennt sich zur Sünde und spricht sich frei. Über neunzig Minuten lang betrachten wir diese Frau bei der Betrachtung ihrer selbst. Zögernd und unerschrocken, weiblich, männlich, kindlich, alterslos. Roswitha lacht ansteckend, als sie erzählt, wie sie sich nach ihrem Suizidversuch bei der Schwester, die sie wiederbelebt hatte, entschuldigen musste. Und wie sie zur Strafe im Bett liegen bleiben musste, ohne auf Toilette gehen zu dürfen. „Aber“, sagt sie „die mussten das dann ja wegmachen!“ Das Lachen steckt an und man fühlt sich seltsam dabei.
Finale mit bestaunenswerter Hingabe
Miriam Tscholl hat mit Wunderblock die Schicksale vierer Menschen in Beziehung zueinander gesetzt. Roswitha Bach, Dörte und Gudrun Kleinbeckes und Thomas Brockow. Ihre Biografien bekommen, fragmentarisch geschachtelt und vorgetragen, eine Bühne ganz für sich allein. Die Zäsuren der Lebenslinien werden zu Anhalter-Bahnhöfen auf dem Zeitstrahl der Geschichte. Die Gründung der DDR, Roswithas Geburt, die Scheidung ihrer Eltern, der Start des Sputnik-Satelliten, der Weglauf aus dem Kinderheim, die Beatles veröffentlichen „Help“. Wunderblock macht die darstellenden Bürger*innen als das fassbar und begreiflich, was sie sind: Zeitzeug*innen, Quellen, Menschen mit Geschichte.
In Roswithas persönlichem Orchestergraben sitzt Mala Faust und lässt den Bogen über die Saiten streichen. Das Finale widmet sie, mit bestaunenswerter Hingabe, Roswitha, die in den Zuschauerraum blickt, als spielte dort die Musik.
Wunderblock – Eine Trilogie der Erinnerung
- nächste Uraufführung: Wunderblock III: Thomas, 22. Oktober, 19.30 Uhr, Kleines Haus
- Zur Programmbeschreibung