Bevor ich gesteinigt werde: ich rede von einer Zeit, die seit mehr als einhundert Jahren Vergangenheit ist. Heute gehören diese Körpergestaltungen zum Alltag, besonders bei der jüngeren Generation. Und wie das mit der Mode so ist, manch einem steht ein Tattoo an bestimmten Körperstellen gut, bei anderen ist sein Dasein ein Grund zum Augenverdrehen.

Seit mehr als 5000 Jahren sind Tattoos als Körperschmuck, als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder zu einer Religion, als Schutzsymbol, als politisch motiviertes Kennzeichen, als Ahnenkult bei Frauen und Männern bekannt. Der Boom seit den Neunzigern des zwanzigsten Jahrhunderts löste die Negativansichten der vergangenen Jahrhunderte ab.
Klischees ums Tattoo
Damit befassten sich auf Anregung eines Lesers der Dresdner Neuesten Nachrichten im Jahre 1903. Dieser fragte, wo man sich in Dresden einen Anker auf die Brust „ätzen lassen“ könne. Bei dem Fragesteller kann man wohl davon ausgehen, dass er beruflich in der Seeschifffahrt tätig war. Schulterzucken bei den DNN. „Das wunderliche Gewerbe wird in Dresden wenigstens noch nicht so berufsmäßig betrieben, als drüben in England.“
Aber man gab zu, dass es einen praktischen Wert für den Seemann als ein besonderes Kennzeichen habe, „wenn er sein Grab in den Wellen oder im fernen feindlichen Lande gefunden“ habe. Denn „für die Erkennung der Leichname war das eintätowierte Zeichen bisweilen ein sicherer Anhalt“.
Neben den Seeleuten wurde diese Art Körpergestaltung auch mit der Verbrecherwelt und allerlei ‚lichtscheuen Elementen‘ in Zusammenhang gebracht. Des Weiteren spielte die koloniale Vergangenheit bei der negativen Bewertung eine gewisse Rolle. Besonders seit der offiziellen kolonialen Besetzung polynesischer Inselgruppen, von Samoa und Teilen Papua-Neuguineas wurden die Tattoos als Kennzeichen für sogenannte ‚primitive Völker‘ im Deutschen Reich bekannt.

Ein weiteres Klischee …
… hat mit der politisch verordneten Feindschaft zum britischen Empire zu tun. Den dortigen Bewohnern wird oft ein Hang zur Dekadenz unterstellt, ganz im Gegensatz zur ‚moralischen Reinheit der Deutschen‘. „Der schwerreiche Engländer lässt sich gern von einem Londoner Fachmann, Sutherland Macdonald, künstlerische bunte Bilder unter Mühen und Schmerzen auf den Körper tätowieren, oft eine monatelange Arbeit. Dafür zahlt er ein kleines Vermögen und trägt schließlich auf dem Rücken farbige Blumen, Tiere oder Portraits von stattlichem Umfang mit sich herum“, so die DNN vor mehr als 100 Jahren.
Wie kriegt man das wieder weg
Das blieb die große Frage. In der Regel behielt man diesen Körperschmuck sein Leben lang, auch wenn er mit der Zeit und dem Alter in der Form einer gewissen, nicht immer vorteilhaften Metamorphose unterlag. Auch bei der Berufswahl konnte er hinderlich sein. „Im Leben ist manchem das ‚besondere Kennzeichen‘ schon recht unbequem geworden. Die Beseitigung ist schwierig, schmerzhaft und als Blutvergiftung lebensgefährlich“, schrieb die Zeitung.

Eine kühne Vorhersage
Eine eindeutige Antwort erhielt der Leser auf seine eingangs gestellte Frage nach einem hiesigen Tattoo-Studio nicht. Weil es wohl zur damaligen Zeit in der sächsischen Residenzstadt einen solchen Laden offiziell nicht gab. Da sei das Gewerbeamt davor. Vielleicht verborgen in einem Neustädter Hinterhof? Das Fazit der DNN lautete deshalb unzweideutig: „In Deutschland findet diese törichte Mode, für welche einst die grimmigsten Wilden tonangebend waren, wohl nie solche Aufnahme.“
Da ist es wieder, das leidige Problem mit den Vorhersagen, ganz gleich, ob es sich um das Wetter handelt oder die persönliche Zukunft durch Kaffeesatzlesen oder die gesellschaftliche Situation mit Corona oder die Aussage, es werde alles wieder so wie davor werden. Sie alle werden durch neue Realitäten immer wieder über den Haufen geworfen.
Nichts ist beständiger als die Veränderung oder wie man Mark Twain, Karl Valentin, Niels Bohr oder Winston Churchill in den Mund legte: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“
Unter der Rubrik „Vor 100 Jahren“ veröffentlichen wir in loser Reihenfolge Anekdoten aus dem Leben, Handeln und Denken von Uroma und Uropa. Dafür hat der Dresdner Schriftsteller und Journalist Heinz Kulb die Zeitungsarchive in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek durchstöbert.






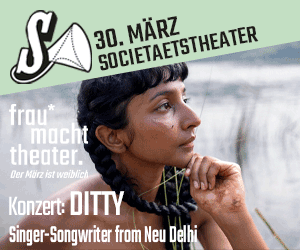



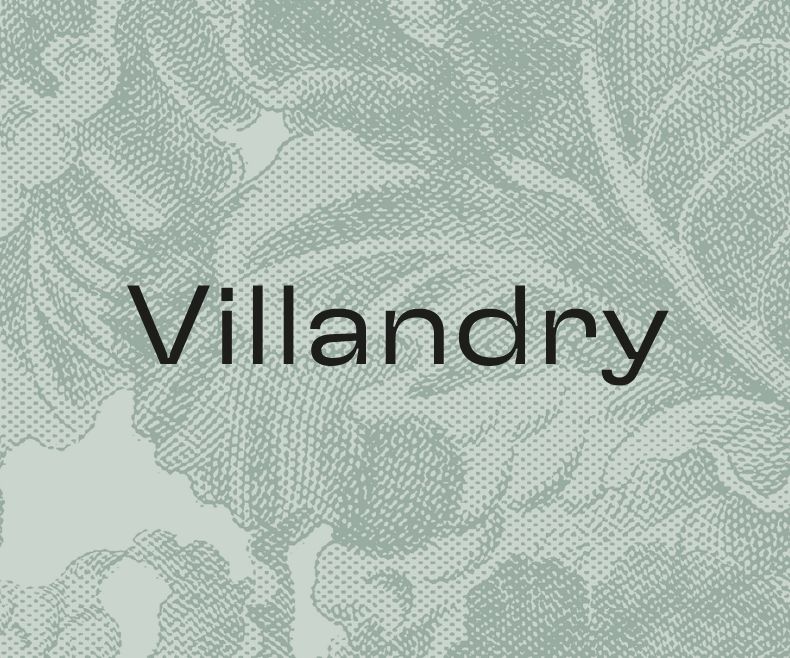







Bei der „Universtätsbibliothek“ hätte ich gern noch ein viertes „i“ :-)
Danke für den Hinweis. Korrigiert.