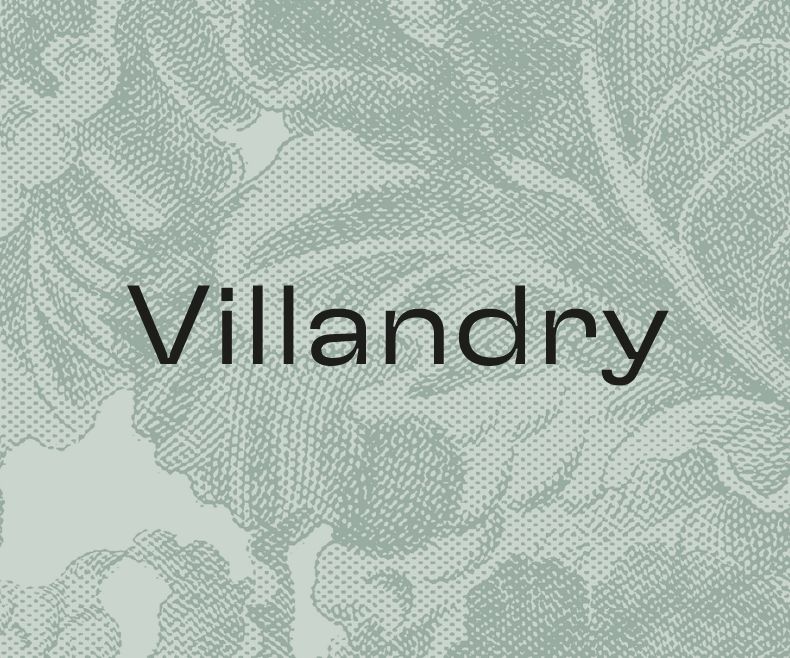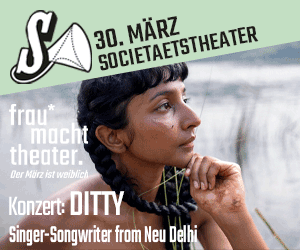Viel zu lange hatte es geschlossen, jetzt hat es seine Tore wieder geöffnet – das Kino! In der Neustadt gab es zur Feier dieses Events gleich eine besondere Veranstaltung: Die Kurzfilmtour war zu Gast im Thalia und präsentierte Prämiertes, Unterhaltsames und Unerwartetes. Darüber freute sich nicht nur Initiatorin Franziska Kache.

Schon von weitem sieht man den bunten Trubel rund ums Thalia. Wie auch sonst auf der Görlitzer Straße sitzen die Neustädter beieinander, lachen und plauschen und lassen den Freitagabend nach der anstrengenden Woche mit einem Wein, einem Feldschlösschen oder einfach nur einer Rhabarberschorle ausklingen. All das ist schon beinahe wieder Alltag geworden in den letzten Wochen, aber außergewöhnlich ist diesmal etwas anderes: Das Kino ist wieder da! Seit ersten Juli haben die Säle wieder geöffnet und heißen Gäste willkommen.
An diesem Abend ist der Anlass, warum sich die Leute um das Thalia drängen, die Kurzfilmtour, organisiert von der gleichnamigen AG mit Sitz in der Förstereistraße. Sie zeigen die mit dem deutschen Kurzfilmpreis prämierten Schmankerl heute im Kino – und nicht nur den Beteiligten ist die Freude anzumerken. „Für mich fühlt sich das alles noch ein bisschen surreal an“, gibt Franziska Kache zu. Sie ist die Organisatorin der Reihe von Veranstaltungen, die in ganz Deutschland stattfinden, um das zehn- bis 30-minütige Bewegtbild präsenter in den Köpfen der Leute zu machen. Heute ist es für sie das erste Mal, dass sie dabei sein kann – und auch das erste Mal im Kino seit dem Lockdown.
Sechs Monate ohne die flimmernde Leinwand – man merkt es auch den Zuschauer*innen an, dass sie das vermisst haben. Der Andrang ist so groß wie die Vorfreude: Erst herrscht Betrieb an der Bar, wo man sich schnell noch was Flüssiges holt, dann gibt es eine kleine Schlange vor dem Ticketverkauf. Mit dem abgerissenen Zettel an den Vorhängen am Einlass vorbei, und schon umfängt einen das schummrige Licht des Kinosaals.
Zieht man die Plätze ab, die des Abstands wegens leer bleiben müssen, ist der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich quetsche mich irgendwo dazwischen und genieße das Gefühl, in den flauschigen Sessel einzusinken und dabei zuzuschauen, wie die Vorhänge an der Seite der Leinwand noch ein Stück weiter aufgehen und die Erwartung der Zuschauer*innen steigt.
Konservative Mütter und Knutschflecke

„Fui zu fui“ (bayerisch für: viel zu viel), ist die Gesamtsituation dem Darsteller im ersten Film „In den Binsen„: der Darsteller mit erkennbar tiefbayerischem Akzent ist noch sichtlich gekennzeichnet von einer wilden Nacht, da ruft ihn seine Mutter: Er soll mit zur Jagd kommen. Er will ihr etwas mitteilen, vor dem er große Angst hat: Der unübersehbare Knutschfleck an seinem Hals ist von seinem Freund. „Du mussd di jetz zommreißen, Mama“, setzt er zu einer Erklärung an, doch seine Mutter ist ganz mit dem Zielen auf frisches Wild beschäftigt und scheint gar nicht zuhören zu wollen.
Ob ein Coming-out gegenüber der konservativen Mama mit den Mettbrötchen im Gepäck und dem Gewehr in der Hand eine gute Idee ist, verrät der Film auf kuriose Art und Weise und sorgt hier sogar für eine Überraschung. Dem Publikum jedenfalls scheint’s zu gefallen: Franziska Kache ist sogar der Meinung, das Baby der Nürnberger Filmakademie-Studentin und Regisseurin Clara Zoe My-Linh hätte am meisten Applaus vom Dresdener Publikum bekommen.
Ungarische Torten – und eine kleine Revolution

Auch im darauffolgenden Film „Land of Glory“ wird mit der Prüderie und Heimatverbundenheit gespielt, dabei geht es eigentlich nur um eine Torte. Die ist aber überdimensional groß, Salami und Paprika dürfen auch nicht fehlen, und zum Anlass des ungarischen Nationalfeiertages in der Form genau dieser Umrisse des Landes von der Schulleiterin bestellt. Dabei bekommt der Balaton einen prominenten Platz, natürlich in der richtigen Größe, aber die Regenbogenflagge wird lieber weggelassen. Und wie konnte die verpeilte Mensafrau einfach Transsilvanien abschneiden, nur damit der Kuchen in den Kühlschrank passt!
Anlässlich dieser Feierlichkeiten sticht der übertriebene Nationalstolz der Direktorin genauso hervor wie das Chaos, das herrscht, um noch alles für die große Feierlichkeit vorzubereiten. Dass dabei die Schüler*innen die ungarische Fahne abgebrannt haben und die Luftballons in Landesfarben in der falschen Reihenfolge anordnen, passt ihr da natürlich überhaupt nicht in den Kram. Und dann hat auch noch die Einserschülerin, die die Rede halten sollte, aus Gruppenzwang zu viel klaren Schnaps während des Sportunterrichts getrunken und muss heimgefahren werden! Ihrem Ersatz, der 17-jährigen Márti, liegt aber gar nicht daran, die Errungenschaften des Landes und der Schule so sehr zu loben: sie wagt zaghaft ihre eigene kleine Revolution. Auch hier kommt man nicht umhin, wegen der zugespitzten Scherze hin und wieder zu schmunzeln und sich bestens von der Regie von Bórbala Nagy unterhalten zu fühlen.
Barbiepuppen erzählen vom Stockhom-Syndrom

Doch es geht schon weiter, mit dem Film „Just A Guy„, der so unverfänglich anfängt wie sein Name, aber dann sehr ernst wird: Während zunächst vor rosa Hintergrund Barbiepuppen von ihrem Liebhaber schwärmen, folgen darauf Bilder und Berichterstattung über sexuelle Gewalt. Fragt man sich erst noch, wie die beiden Dinge zusammenhängen, so wird einem nach und nach der schockierende Zusammenhang klar: Wie beiläufig erzählen die animierten Frauen, bei denen nur die Augen echt sind, die schreckliche Geschichte sexueller Ausbeutung und Abhängigkeit – und der Unmöglichkeit, mit dem Briefe schreiben und Besuchen aufzuhören und einfach den Kontakt abzubrechen.
Sie driften dabei ab in eine Mischung aus Stockholm-Syndrom und bitterem Zynismus gepaart mit einer toxischen Zuneigung für einen Mann, der wegen Vergewaltigungen im Gefängnis sitzt. Ihre quitschig-fröhlichen, verliebt klingenden, aber grausamen Erzählungen brennen sich ins Gedächtnis ein: „Mich stört beim SM, dass die Leute nur so tun, als würden sie vergewaltigen. Richard vergewaltigt wirklich, und das liebe ich so an ihm“ ist da nur ein Beispiel, abgesehen von den erotischen Fotos, die sie ihm in den Todestrakt senden.
Da schockiert es nur noch mehr, dass am Ende deutlich wird, dass die Geschichte nicht erfunden ist: die drei Frauen gibt es wirklich, das Ganze ist eine Dokumentation um den Sexualstraftäter Richard Ramirez, der in den 80ern verhaftet wurde. Wie eindrücklich der Film der Regisseurin Shoko Hara war, wird auch im Saal deutlich: wurde vorher noch ab und zu laut aufgelacht, so ist es jetzt totenstill, nur hier und da hört man ein beklommenes Flüstern.
AfD, Hippies und Gegenwartsbewältigung

Auflockerung bringt da das Hakenkreuz nicht gerade, das am Anfang des nächsten Films erscheint. Immerhin wird es dann übermalt, und der Junge, der da in dem Klo herumkritzelt, ist zwar Jude, aber will auf gar keinen Fall nur als Opfer dastehen. Als ihn ein Mitschüler antisemitisch beleidigt, kann er sich nicht zügeln und haut drauf. Daraufhin wird er prompt von der Schule suspendiert, weil er sich weigert, dem Typen die Hand zu reichen, der es witzig fand ihn mit der Vergasung der Juden aufzuziehen. Er nimmt die Zuschauer*innen auf mitreißende Art und Weise mit: Erst geht es Nachhause, wo er zeigt, wie seine russisch-orthodoxen Eltern darauf reagieren. Seine Mutter gibt ihm den Blumenstrauß vom Küchentisch und sagt ihm, er soll sich entschuldigen, während seine Freundin bereit ist, mit dem Pfefferspray nachzulegen.
Und dann sind da noch die Leute, die ihm unbedingt beweisen müssen, dass ihre Vorfahren ja keine Nazis waren, Hippiemütter, die denken, dass er ein Assi ist nur weil seine Familie sich nicht mehr als eine Sozialwohnung im Ruhrpott leisten kann und übereifrige Lehrerinnen, die unbedingt wollen, dass er im Unterricht von den traumatischen Erfahrungen seiner Familie bei der Shoah erzählt. Oder sein Opa, der beim AfD-Stand stehen bleibt und sagt: „Das sind die Einzigen, die uns wirklich noch zuhören.“ Durch all das saust der Film explosiv wie sein Name – „Masel Tov Cocktail“ – und endet mit einem Tritt in die Fresse für alle, die der Meinung sind, Antisemitismus gehöre der Vergangenheit an. Mit dieser unkonventionellen Herangehensweise an ein akutes Thema konnten die Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch einige Preise abräumen.
Das Kurzfilm-Kinoerlebnis: Mutig, frei, politisch

„Ooch, ich dachte da kommt noch einer“, höre ich hinter mir und weiß nicht genau, ob das auf die letzte Szene im Film gemünzt ist oder die Zuschauerin einfach nicht genug vom Kino bekommen kann. Denn so schnell wie sie angefangen haben, sind sie auch schon wieder vorbei, das ist der Nachteil an Kurzfilmen. die Leute hieven sich von ihren Sitzen, und das Licht geht an. „Trotzdem ist der Kurzfilm mitnichten eine Fingerübung“, weiß dazu Franziska Kache zu sagen, die sich natürlich für das weniger lang dauernde Bewegtbild ausspricht. „Er kann mutiger sein!“ Freier, politischer, kurzweiliger – oft würden sich die Spielfilm-Macher einiges abschauen von Techniken, Inhalten und Szenen, die vorher beim kleineren Bruder vorkamen.
Die Initiatorin der Kurzfilm-AG ist begeistert. „Das kann man einfach gar nicht vergleichen!“, schwärmt Franziska Kache vom Kino-Erlebnis im Vergleich zum Fernsehabend im Wohnzimmer. „Filme sehen einfach viel besser auf der Leinwand aus!“ Mit dem Thalia verbindet sie nicht nur, dass es schon immer ihr „erklärtes Lieblingskino“ war: Früher hat sie selbst mal hier gearbeitet und konnte wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein paar Filmszenen aus den Vorstellungen erspähen.
„Es ist so schön, jetzt wieder anzufangen!“, sagt sie mit strahlenden Augen. Der Rummel während der Vorstellung hat sich jetzt wieder an die Bar verlagert. Während entspannte Musik im Hintergrund leise vor sich hin dudelt, poliert der Barkeeper seine Gläser bis aufs Feinste. Zwar sei einiges los, aber das sei sein erster Arbeitstag, um sich nach dem Abi noch was dazu zu verdienen, erzählt er bereitwillig und scherzt mit seiner Kollegin, die ihn lobt: „Gut machst du das! Wenn du so weitermachst, dann geht’s dir wie in diesen amerikanischen Filmen!“ Und wenn aus dem Traum vom Tellerwäscher zum Millionär nichts wird, dann bleibt ihm immernoch das Kino…