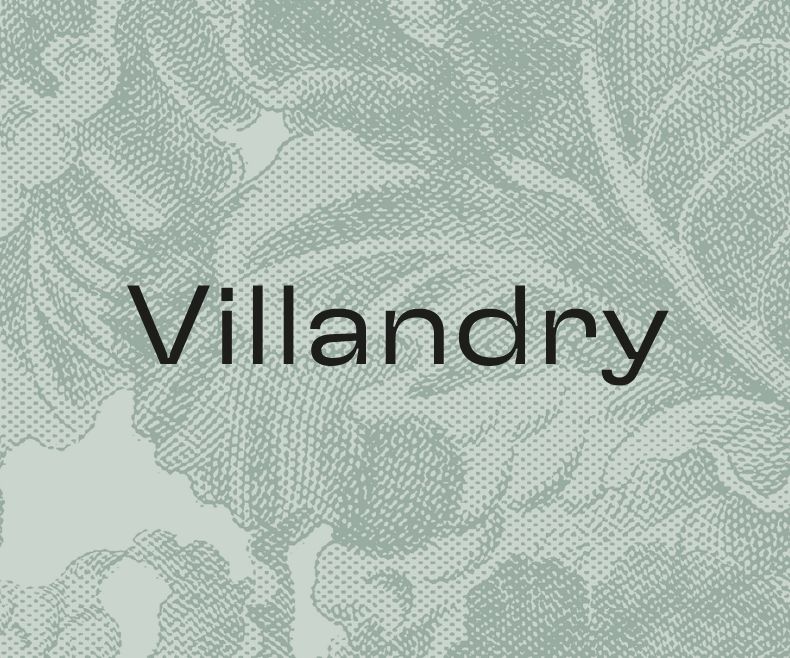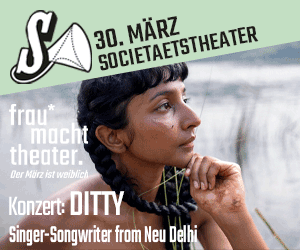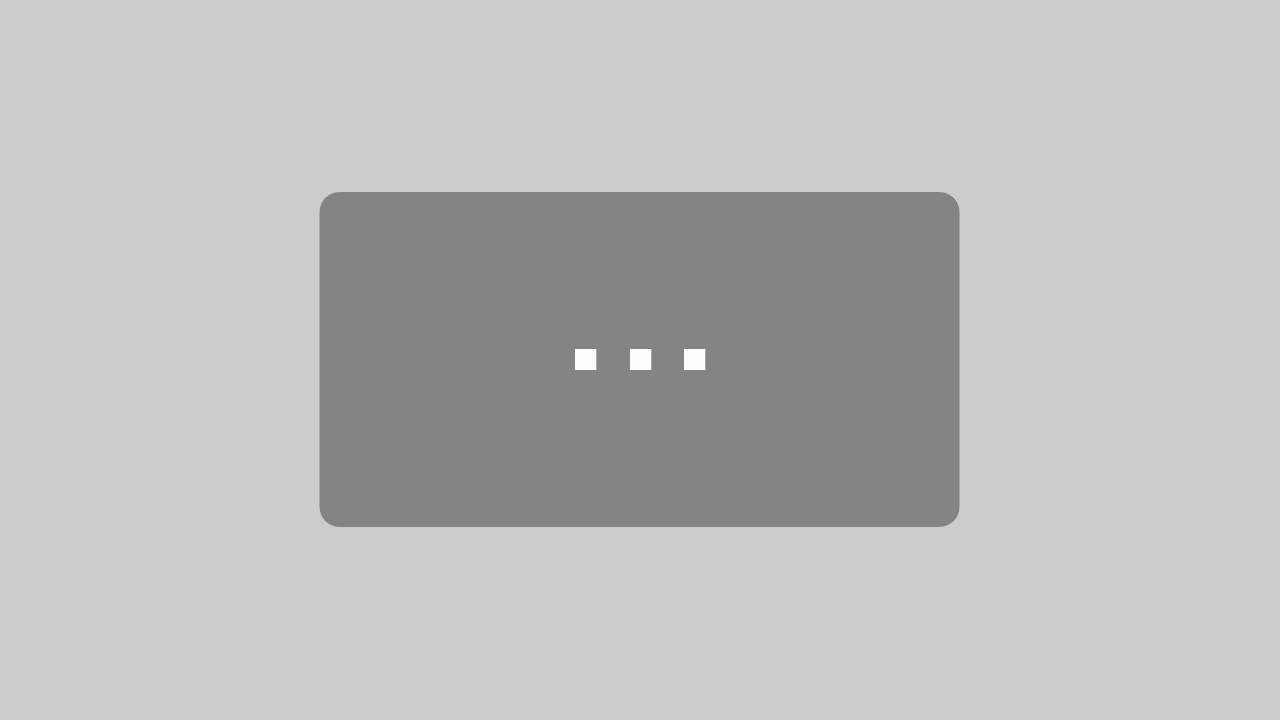Vor dem Release-Konzert zur neuen EP „Kleinstadtherz“ am Donnerstag im Ostpol hatte sich die Künstlerin Paula Peterssen Zeit genommen, um dem Neustadt-Geflüster ein paar Fragen zu ihrer Musik zu beantworten.

Deine neue EP wird „Kleinstadtherz“ heißen. Was bedeutet es für dich ein Kleinstadtherz zu besitzen? Und wie lässt es sich mit so einem in einer Großstadt (wie Dresden) leben?
„Kleinstadtherz“ heißt nicht nur die EP, sondern auch ein Song auf der Platte. In dem Song geht es darum, dass mein Kleinstadtherz nun „an der Hauptverkehrsader“ schlägt. Eigentlich ist es eine Metapher für das Lebensgefühl, das sich ändert. Ich bin behütet in einer kleinen Stadt groß geworden und habe mich in meiner Kindheit und Jugend mit den Dingen in meinem kleinen Kosmos beschäftigt. Als ich zum Studium wegzog, danach einen Freiwilligendienst in der Ukraine absolvierte und dann in die Arbeitswelt eintauchte, hat sich meine Sicht auf die Welt verändert. Außerhalb meines Wirkungskreises gibt es so viele Probleme auf dieser Welt, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Das kann ab und zu überfordern und auch entmutigen und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht abstumpft und so tut, als hätte das Weltgeschehen nichts mit einem selbst zu tun.
Der Song ist ein Versuch, sich von „der Welt“ abzugrenzen und sich trotzdem nicht vor dem, was um einen herum passiert zu verschließen und für Veränderungen offen zu bleiben. Ein Schlüsselmoment in dem Song ist die Bridge in der dich singe: „Meine Haut ist viel zu dünn, als das da dickes Fell wachsen kann. Mein Herz schlägt viel zu laut, als das du es verfehlen kannst.“ Es ist also nicht so leicht mit einem Kleinstadtherz in einer großen Stadt zu leben, aber hier schlagen noch ganze viele andere Kleinstadtherzen, die sich gegenseitig ein bisschen Mut machen können.
Von deiner Singleauskopplung „2012“ haben wir im März bereits berichtet, jetzt hast du noch zwei weitere Lieder veröffentlicht. „Im Türrahmen“ erinnert an „Mittelmaß“ der Band Acht Eimer Hühnerherzen – welche Musik beeinflusst deine eigene am meisten?
Oh, mit Acht Eimer Hühnerherzen wurde meine Musik noch nie verglichen. Aber ich mag den Vergleich sehr, da es bei ihren Songs auch in erster Linie um die Texte geht. Das ist tatsächlich das, was mir beim Schreiben und auch beim Hören von Songs am wichtigsten ist. Ich werde oft für neue Songs inspiriert, wenn ich Musik höre, aber es gibt für mich keine bestimmte Art von Musik oder bestimmte Bands, die mich beeinflussen. Ich versuche beim Songwriting so wenig wie möglich beeinflusst zu sein, egal ob von anderer Musik oder von dem Gedanken, dass ich die Songs irgendwann mal vor anderen Menschen spielen werde. Ich finde das zerstört die Echtheit in einem Song.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wenig Einfluss darauf nehmen kann, was für einen Song ich schreibe. Ich schreibe eigentlich meistens nur das auf, was aus mir rauskommt. Immer wenn ich mit einem gewissen Anspruch rangehe und mir denke „Jetzt mach ich mal was ganz anderes.“, dann wird das meistens Mist. Ich muss mich von meinen eigenen Erwartungen befreien und loslassen, dann entsteht ein guter Song – auch wenn er wieder nur aus 4 Akkorden besteht und nicht besonders anders als meine restlichen Songs klingt. Ich muss es halt fühlen, nur dann können es eventuell auch andere fühlen.

Im zweiten Lied „Zu meinem Vorteil“ übt dein lyrisches Ich starke Kritik an sich selbst aus – wie viel Eigenkritik ist gesund für Kunstschaffende?
Ja, in „Zu meinem Vorteil“ bin ich tatsächlich sehr selbstkritisch. Aber mich nervt es, wenn man in einem Song den erhobenen Zeigefinger direkt ins Gesicht geklatscht bekommt. Dennoch sind kritische Songs wichtig, deshalb hab ich mich selbst kritisiert und die Hörer*innen können sich angesprochen fühlen oder so tun, als würde ich sie nicht mit ansprechen.
Eigenkritik ist nur in einem gewissen Maß gut – vor allem, wenn man Kunst macht. Es ist unheimlich wichtig, dass man seine eigene Kunst mag und auch irgendwann damit zufrieden ist. Sonst kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und traut sich am Ende nicht, anderen zu zeigen, was man geschaffen hat. Natürlich ist auch ein gewisses Maß an Selbstkritik hilfreich, um sich weiterzuentwickeln und seine eigene Kunst auch kritisch zu betrachten. Vermutlich muss da jede und jeder ein eigenes „Wohlfühlmaß“ finden. Ich selbst gehöre eher zu der Kategorie „Ach, ich lass das jetzt so.“. Keine Ahnung, ob das für mich gut oder schlecht ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Paula Peterssen
- Mehr erfahren unter www.paulapeterssen.de