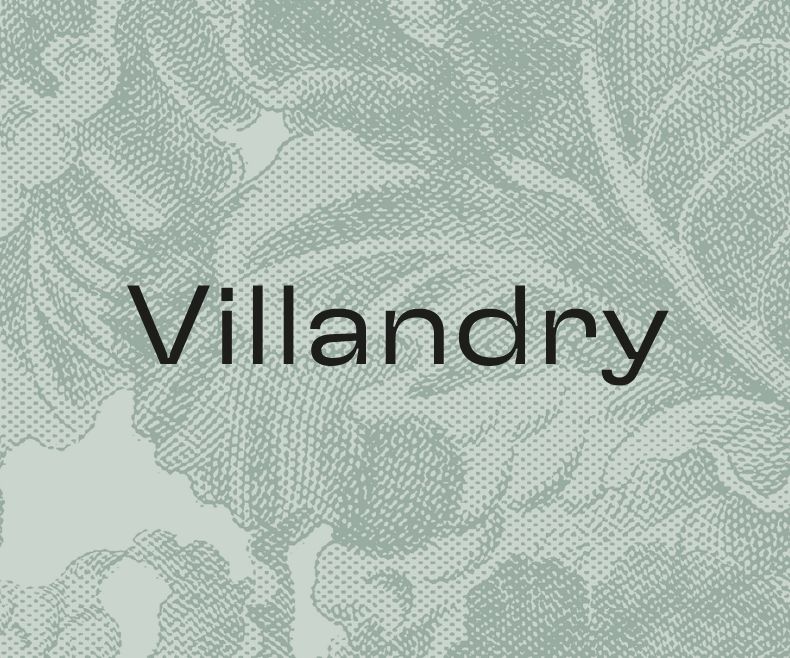Der Organist der Martin-Luther-Kirche der Dresdner Antonstadt legte große Gefühle an diesem nasskalten Januartag 1915 in die Tastatur auf der Empore der Martin-Luther-Kirche. Ganz zart begann er das „Deutsche Requiem in D-Moll“ von Johannes Brahm zu intoniere. Nach wenigen Minuten setzte der Chor ein. In der mäßig besetzten Kirche gedachten die Familien ihren kürzlich gefallenen Söhnen, Brüdern, Vätern, Freunden und Nachbarn dieses immer brutaler werdenden Krieges, der schon seit August 1914 andauerte. Hier und da hörte man ein leises Schluchzen, ein verlegenes Hüsteln. Die Köpfe gesenkt und die Hände gefaltet, ließen die Anwesenden die tröstenden Klänge in ihr Innerstes. Diese Töne linderten ein wenig den Schmerz des Verlustes.

Requiem
Unter ihnen saßen die Eltern von Franz Menzel, dem einzigen Sohn der Gastwirte vom Restaurant „Zum Alberttheater“ in der Alaunstraße und Emil, der Freund des in Frankreich vor einer Woche Gefallenen. Franz wurde das Opfer eines Querschlägers.
Dabei war er einer derjenigen der Jugendbande aus der Alaunstraße, der mit patriotischem Hurra und „Heil dir im Siegerkranz“ sich im schönen Sommer des vergangenen Jahres freiwillig bei der Königlich-Sächsischen Armee in der Albertstadt meldete. Walter und Berthold taten es ihm gleich und sind, der eine in Belgien und der andere in Russland, kurze Zeit später gefallen.
Emil erinnerte sich an die schönen Tage, als sie zu viert die Neustadt unsicher machten, den Mädchen hinterher pfiffen und die in die Jahre gekommenen Polizisten ärgerten. Über diese Gedanken umspielte, von den anderen unbemerkt, ein Lächeln seinen Mund, obwohl er eigentlich heulen müsste. Dann schoben sich die vier Freunde vor seine Augen. Wie sie lachend von Kneipe zu Kneipe zogen, Witze erzählten und Trinksprüche grölten wie: „Es lebe die Liebe, der Wein und der Suff, die christliche Seefahrt, der Papst und der Puff.“
Dann trat die eiskalte Gegenwart erbarmungslos ans Licht und entlockte Emil doch noch ein paar Tränen. Die bunten Glasfenster hatten passend in der einsetzenden Dämmerung ihre dunklen Farbtöne angelegt. Dann endete der erste Satz des Requiems „Selig sind, die da Leid tragen“.
Tod auf dem Feld der Ehre
Als der Pastor diese Worte aussprach, versteiften sich die Gesichtszüge vieler anwesender Männer und die Frauen fingen mit Taschentüchern ihre Tränen auf.
Auch für Emil klangen diese Worte unwirklich. Ehre, was für eine Ehre?

In den Tageszeitungen wurden Briefe von Frontsoldaten abgedruckt. Beim Lesen bekam man den Eindruck, dass sich die Kämpfer nicht im Krieg, sondern auf Studienreise in Europas schönsten Gegenden befanden. Da ist von gemütlichen Unterständen in den Schützengräben die Rede. Fast wie im Wohnzimmer zu Hause. Es gab eiserne Öfen, um der winterlichen Kälte zu trotzen. Sogar Spiegel waren vorhanden. Schließlich solle man auch im Kampf nicht liederlich aussehen. Deutsche Ordnung halt. Mittags gab es Rinderbraten mit Kartoffeln. Am Nachmittag stärkte man sich mit Tee und Rum.1 Ab und zu schickte der Feind einige Grüße per Schusssalven herüber, aber daran störten sich die Soldaten nicht, so in der Feldpost zu lesen. Es fehlten nur noch Badewannen, weiche Betten, Blasmusik und Damen.
Emil schüttelte mit dem Kopf über so viel Schönfärbereien. Aus einigen Briefen von Franz, sofern der Zensur diese entgingen, erfuhr er ein ganz anderes Bild. Die Freude am Krieg ging ihm schnell verloren. Liegen im Schlamm, Kopfeinziehen, damit man nicht getroffen wurde. Granatwerfer klingen wie Orgeln und das Essen in den Blechgeschirren sei kalt, das Brot mit Schrot und anderem Zeugs angereichert und der Regen machte die Suppe dünn.
Sogar der Kaiser soll sich im Feld wie ein Soldat verhalten, Erster unter Gleichen. Hieß es in den Zeitungen. Naja, Kugeln ließ er sich nicht um die Ohren fliegen. Dafür schüttelte er viele Hände und reichte Eiserne Kreuze massenweise aus. Das gab zumindest eine gute Presse, meinte Emils Vater.2
Und in den Lazaretten tummelten sich Künstler, Sänger und Musikkapellen zur Frontbespaßung. Das sei ein wichtiger Teil für die moralische Erbauung der schwer verwundeten Soldaten, die kriegsversehrt und psychisch geschädigt heimkehrten. Oft erlagen sie auch dem Artilleriefeuer und den Verwundungen.
Die Verlustlisten
Die wurden immer länger. Die vom Kriegsministerium veröffentlichten Listen passten schon seit Wochen nicht mehr auf die vorhandenen Seiten der Tageszeitungen, zumal auch deren Papier rationiert wurde.3 Kürzlich fand Emil eine Liste mit ihm bekannten Turnern aus dem Verein für Neu- und Antonstadt in der mittleren Alaunstraße. Ihm tat das Herz weh. Alle hatten im letzten August gehofft, nein, sie waren voller Zuversicht, Weihnachten wieder zuhause zu sein. Daraus wurde nichts. Nach Hause kam keiner, nicht mal die Leichen der Gefallenen. Die toten Körper wurden in der Fremde verscharrt. Auf dem Feld der Ehre.

Emil wurde des Öfteren darauf angesprochen, warum er nicht auf diesem Feld kämpfe, sondern sich hier in der Heimat verkrieche. Er hatte aber keine Lust, jedem zu erklären, dass er wegen seiner Schmächtigkeit und des Mangels an Muskelmasse vom Militärdienst vorläufig zurückgestellt sei. Im Innersten war er froh darüber.
Unter der Oberfläche der Heimatfront rumort es
Und auch sonst sei in der Heimat alles in Ordnung, hieß es allenthalben in den Gazetten. Die Soldaten kämpften unbeschwert für Kaiser, König und Vaterland. Über das Zuhause solle sich der brave Bürger und der Arbeiter keine Sorgen machen. So möchte es die Generalität haben. Aufmüpfige wurden mundtot gemacht oder in die vordersten Schützengräben geschickt.
Und schon wurden erste Lebensmittel rationiert. Mit der Butter fing es an. Schuld daran seien natürlich immer andere, die Holländer, Schweden, Dänen oder Russen zum Beispiel, die wegen des Krieges keine Butter mehr oder nur eingeschränkt lieferten. Besonders die sehr billige russische Butter aus Sibirien fiel weg. Und natürlich hatte die Belieferung der Front Vorrang. Das gute Weizenbrötchen wurde vor einigen Tagen sogar gegen minderwertige Mehlsorten eingetauscht.4
Zudem erfanden die Propagandaleute in der Armee sogenannte Sammlungen von Wollsocken, Unterhosen, Jacken und Stiefel oder animierten die noch begüterten Bürger neue warme Sachen in den Kaufhäusern für die Soldaten in den Schützengräben zu kaufen.5
Mit dem siebenten Satz von Brahms´ Requiem „Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben“ und dem Segen des Pastors endete der Gedenkgottesdienst.
Am Ausgang kondolierte Emil den elterlichen Wirtsleuten vom Franz Menzel. Diese nickten stumm. Und dann fixierte Frieda Menzel den Freund mit versteinertem Blick. Ein Schauer lief ihm den Rücken runter, als er in ihren Augen den wütenden Vorwurf las, warum musste ihr Franzel sterben und du nutzloser Bengel lebst und verkriechst dich zuhause hinter dem warmen Ofen.
Emil blickte verschämt nach unten und verschwand in einer Nebenstraße. Zuhause erwartete ihn der königliche Einberufungsbefehl.
Anmerkungen des Autors
1 Feldpost, aus Dresdner Nachrichten vom 12. Januar 1915
2 Dresdner Nachrichten vom 13. Januar 1915
3 Im Feldlazarett, aus Dresdner Nachrichten vom 8. Dezember 1914
5 Annonce aus Dresdner Nachrichten vom 17. Januar 1915
Unter der Rubrik „Vor 100 Jahren“ veröffentlichen wir in loser Reihenfolge Anekdoten aus dem Leben, Handeln und Denken von Uroma und Uropa. Dafür durchstöbert der Dresdner Schriftsteller und Journalist Heinz Kulb die Zeitungsarchive in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Der vorliegende Text ist literarischer Natur. Grundlage bilden die recherchierten Fakten, die er mit fiktionalen Einflüssen verwebt.