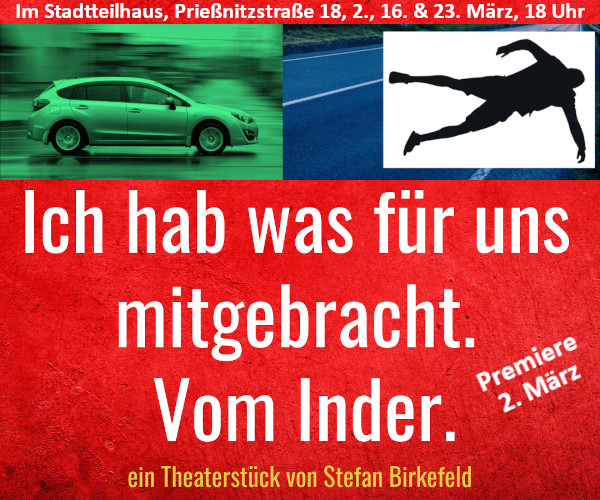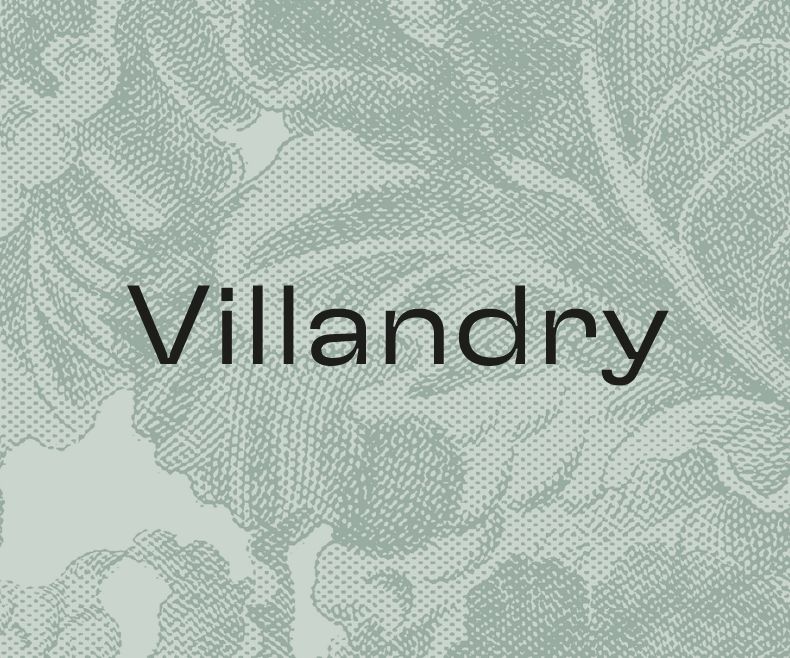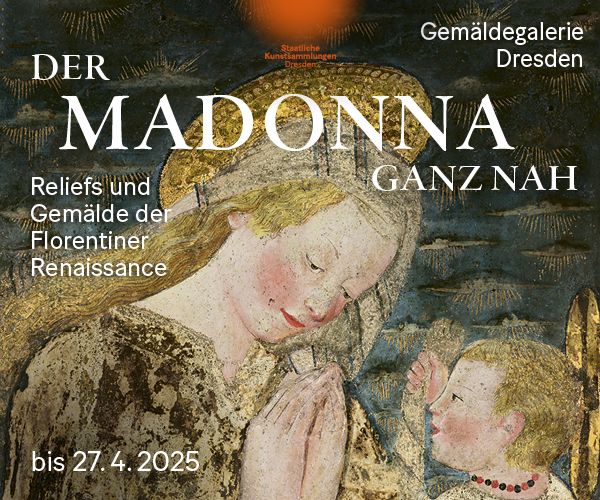„Ist Walter da?“, fragte Edgar die Haushälterin beim Landesforstamtsleiter in der Theresienstraße 25. „Geh hoch, Edgar. Er ist in seinem Zimmer.“

Als er eintrat, dudelte auf dem Grammophon eine Platte von Max Kuttner und Walter bewegte sich im Rhythmus von „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn…“. Im Anblick seines Freundes sauste der auf ihn zu und tanzte einige Runden mit ihm. Dann ließen sie sich lachend in die Sessel fallen und Walter spendierte eine Limonade. „Bier gibt’s heute aber nicht. Ich muss noch für die Hochschule an einer Hausarbeit über Forstschädlinge schreiben.“
Das akzeptierte der am Kulturwissenschaftlichen und Philosophischen Institut der Technischen Hochschule bei Victor Klemperer Romanistik studierende Edgar Rodschinka. „Kein Problem. Ich bleibe nicht lange. Wollte dir nur sagen, dass der große Sturm letzte Nacht die Riesenantenne zwischen dem Rathausmann und dem Turm der Kreuzkirche zerrissen hat. Nun stehen die Probesendungen und vielleicht auch die Eröffnung des Senders Dresden in Frage.“1

Walter grinste. „Entweder passte dem Rathausmann die Fußfessel nicht oder der liebe Gott schickte den Sturm, um zu verhindern, dass seine Kirche, auch wenn es sich in diesem Fall um eine protestantische handelte“, wie der Katholik süffisant bemerkte, „durch die gottlose und lasterhafte Republik und den neuen Techniken verunglimpft wird.“
Sturmschäden
Die Nachrichtenstelle der Oberpostdirektion reagierte für heutige Verhältnisse ungewöhnlich schnell. Binnen eines Tages wurde die durch den Sturm beschädigte Fächerantenne durch eine um 10 Meter verkürzte Doppel-T-Antenne ersetzt. Man versicherte, dass der Beginn der Versuchssendungen nicht darunter leiden würden. Das Sendezentrum im fünften Stock des Rathauses funktioniere auch wieder.2

Brüllender Sender
Des Weiteren beschwerten sich viele Dresdner, dass es bisher zu ohrenbetäubendem „Brüllen“ während der Versuchssendungen käme.3 Einige bekamen sogar Angst, dass diese Geräusche dauerhafte Hörschäden verursachen könnten und brachten ihre neu erworbenen Radiogeräte zu den Händlern zurück. Andere dachten, Engel sprächen zu ihnen, was die Kirchen jeglicher Couleur als Blasphemie zurückwies. Dahinter steckte auch ein Abstimmungs- und Kompetenzproblem zwischen dem anfänglich noch überwiegenden Wirtschaftsfunk und den Unterhaltungsfunk für die Bürger, der rasch die Oberhand gewann. Das war rufschädigend und die Reichspost musste schnell handeln. So wurde damit experimentiert, diese Störungen in der Leipziger Fernleitung zu mildern. Eine wesentliche Teilschuld hatten auch die oft von mangelnder Qualität beherrschten Empfangsgeräte.
Die besten Radiogeräte kamen dann aus Dresden
Der Techniker Hermann Mende und der Kaufmann und Geldgeber Rudolf Müller gründeten am 1. November 1923 im Industriegelände an der Meschwitzstraße die Fa. Radio H. Mende & Co. GmbH. Dann 1925 der Glücksfall. Da stießen der Ingenieur Rudolf Günther als Technischer Direktor und Mendes Neffe Martin als begnadeter Verkaufsleiter hinzu. 1925 produzierte man auf der Königsbrücker Straße im ganzen Jahr etwa 2.000 Geräte. Schnell entwickelte sich die Dresdner Firma zu einem der größten deutschen Produktionsfirmen für Rundfunkgeräte. 1937 feierte man den einmillionsten produzierten Radioempfänger. Ein Jahr später war jedes dritte Empfangsgerät in Deutschland ein Mende. Doch dieser Erfolg hatte auch eine dunkle Seite.4

Der erste Radiosender Sachsens stand in Leipzig
Das ärgerte die Dresdner Radiofreunde. In Leipzig entstand die privatwirtschaftliche Mitteldeutsche Rundfunk AG (MIRAG)5. Ein Jahr zuvor, zum Beginn der Frühjahrsmesse am 2. März 1924, startete der Sender Leipzig offiziell sein Programm, der neben dem Berliner Sender aus König Wusterhausen auch in Dresden zu empfangen war. Leipzig sollte nach den Maßgaben des Reichstelegrafenamtes den Mitteldeutschen Rundfunkbezirk abdecken. (Die MIRAG ist somit einer der Vorläufer des heutigen öffentlich-rechtlichen MDR.) Dresden wurde ein Leipziger Nebensender.
Das Rundfunkstudio Dresden
Die MIRAG schuf in ihrem Sendegebiet mehrere „Studios“, um das Mitteldeutsche Terrain im Programm zu widerspiegeln. Eigentlich nannte man sie „Besprechungsraum“. Der Dresdner befand sich nicht im Rathaus, wo die Sendetechnik nach einigem hin und her untergebracht werden konnte, sondern passend im Hotel „Zur Reichspost“ in der Großen Zwingerstraße 18.6 Im Erdgeschoss gab es auch zwei Besprechungsräume für ausländische Sender.
Anfänglich war die Ausstattung noch recht unterentwickelt. Der Besprechungsraum sah einem bürgerlichen Salon für Kränzchen und kleinen Konzerten ähnlicher als heutigen Studios. Bekannt war bereits, dass man schallschluckende Elemente brauchte. Die Wände erhielten dicke Fliesvorhänge, die Fußböden weiche Unterlagen mit Nummern, damit die Musiker und Sprecher schnell ihre Plätze finden konnten.
Alles war live. Jeder falsche Ton aus dem Klavier, jeder Versprecher, jedes unerwartete Betreten des Raumes durch eine Person, die laut rief, ob jemand einen Tee wünsche, wurde übertragen. Wenn ein Trompeter während einer zweistündigen Sendung aufs Klo musste, dann nur leise raus und wieder rein. Die anderen mussten ohne ihn weiterspielen. Diese lebensnahen Sendungen fanden zwar höchstes Vergnügen bei den Hörern, aber größte Missbilligung bei den um künstlerische Qualität bemühten Verantwortlichen der oberen Etage. Mit der Zeit entwickelte sich der Sender der Landeshauptstadt aber zu einem weithin bekannten Konzertsender.
Übertragungswege
Vom Besprechungsraum gelangten die verstärkten elektrischen Niederfrequenzwellen über eine Telefonleitung zum Rathaus. Von hier gingen zum einen die Signale mittels Starkstrom über den Dresdner Sender zu den Empfangsgeräten, wo sie transformiert wurden, damit man Sprache und Musik wieder hören konnte. Zudem ging ein Signal über die Telefonleitung zum Leipziger Sender und über diesen nach Berlin.
Bei der geringen Frequenzbreite im Mittelwellenbereich für die Sparte Unterhaltung und Bildung gab es in ganz Deutschland nur Platz für 20 bis 25 Stationen. Es musste darauf geachtet werden, damit man sich nicht gegenseitig störte.7 Dazu bedurfte es auch einer internationalen Abstimmung. Auf Grund des Versailler Vertrages hatte es Deutschland diesbezüglich schwer.
Das Studentenleben forderte seinen Tribut
„Weißt du Edgar, ich habe keine Lust, mich mit Borkenkäfern und irgendwelchen Krabbelviechern zu beschäftigen. Komm, wir holen Alwin und Karl ab und reiten in den Neustädter Hof ein. Meine Kehle könnte eine hopfigere Feuchtigkeit als diese süße Limonade gut vertragen.“
Die offizielle Eröffnung des Senders Dresden folgt im Teil 3.
Anmerkungen des Autors
1 Dresdner Nachrichten vom 5. Februar 1925
2 Dresdner Neueste Nachrichten vom 10. Februar 1925
3 Dresdner Neueste Nachrichten vom 12. Februar 1925
4 „Audio-Rundgang zur Zwangsarbeit bei Radio Mende“, Neustadt-Geflüster vom 10. Februar 2025
5 Dresdner Neueste Nachrichten vom 14. Februar 1924
6 www.rundfunkschaetze.de/sender-dresden-1924
7 Dresdner Neueste Nachrichten vom 22. Mai 1924
Unter der Rubrik „Vor 100 Jahren“ veröffentlichen wir in loser Reihenfolge Anekdoten aus dem Leben, Handeln und Denken von Uroma und Uropa. Dafür durchstöbert der Dresdner Schriftsteller und Journalist Heinz Kulb die Zeitungsarchive in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Der vorliegende Text ist literarischer Natur. Grundlage bilden die recherchierten Fakten, die er mit fiktionalen Einflüssen verwebt.